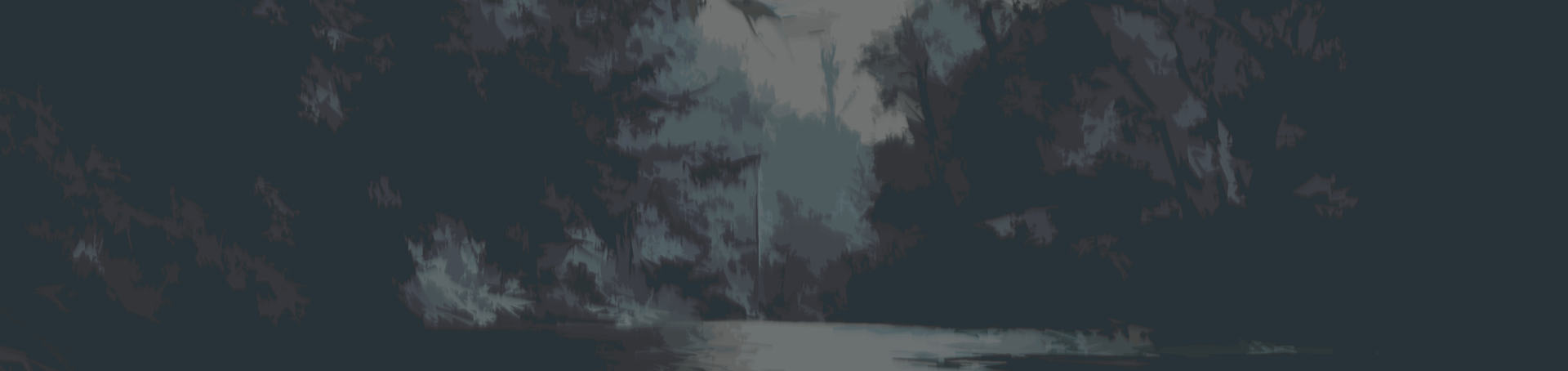626
von Casino Hille
'Q Branch' - MODERATOR
Star Trek: Der Zorn des Khan
"…the great flood-gates of the wonder-world swung open, and in the wild conceits that swayed me to my purpose, two and two there floated into my inmost soul, endless processions of the whale, and, mid most of them all, one grand hooded phantom, like a snow hill in the air." - Herman Melvilles "Moby Dick" gilt heute - lange nach 1851 - als einer der bedeutsamsten Romane der globalen Literaturgeschichte. Melvilles Allegorie auf den Hass und den Schmerz eines verletzten Individuums ist ein langer, bedeutungsschwangerer und facettenreicher Roman, dessen Sogkraft sich nur die wenigsten entziehen können, gelungen getragen durch das Motiv der Rache, dass niemand außer ihm besser hätte aufbereiten können. Kein Wunder also, dass ein solcher Klassiker bis in die Moderne viele Adaptionen in verschiedensten Medien erhält. Doch eine der wohl ungewöhnlichsten - und gleichzeitig besten - aller Umsetzungen scheint auf den ersten Blick mit den Weiten der Ozeane wenig gemein zu haben: Nicholas Meyers "Star Trek: Der Zorn des Khan".
"Call me Ismael." – So beginnt Melville seinen Roman. Doch Ismael gibt es in Meyers 82er Umsetzung der Legende vom weißen Wal gar nicht. Und auch keinen Queequeg, keinen Elias, keinen Daggoo, keinen Pip und keinen Starbuck, nicht einmal die Pequod ist vertreten. Sie wurde in "Enterprise" umbenannt. Doch die Geschichte, die Motive, sie bleiben dieselben, wie schon im fabelhaft düsteren Opening der Kobayashi Maru-Persönlichkeitstest einer jungen Enterprise-Kommandantin offenbart: Hier geht es um Rache. Familie. Freundschaft. Leben. Und Tod. Und da tritt er aus dem Licht wie eine lebende Legende in die Düsternis hinein: William Shatner alias James T. Kirk, der in altkluger Überlegenheit den souveränen Hasardeur spielt - Shatner wie Kirk gleichermaßen. Denn im Verlauf der 113 eng bepackten Minuten eröffnet Meyer einen Blick auf den bekannten Protagonisten, den man so nicht hätte erwarten dürfen: Er entlarvt ihn. Als Quacksalber, Sprücheklopfer. Kirk, der voller Weisheit scheint, weiß am Ende mit seinen leeren Phrasen und selbstverhüllenden Worten nichts anzufangen und hat sich selbst nie den Realitäten des Lebens gestellt - und am allerwenigsten der Unausweichlichkeit des Todes. Er musste sich schlicht und einfach nie damit auseinandersetzen, er wusste immer, sich dem Verlust zu entsagen. Meyer durchbricht diesen Kreis, er lässt ihn altern, verbittern und den Verlust eines Freundes kennenlernen. Kirk muss erkennen, dass Leben und Tod in direkter Kausalfolge zueinander stehen und man sich beidem gleichermaßen stellen muss. In gewisser Hinsicht ist "Der Zorn des Khan" sein Kobayashi Maru-Test.
Nicholas Meyer brachte mit dem ersten Kino-Sequel des "Star Trek"-Franchises ein Meisterwerk in die Lichtspielhäuser, welchem inhaltlich und ästhetisch eine Zeitlosigkeit innewohnt, die nicht nur Mr. Spock als faszinierend titulieren würde und das Science-Fiction-Umfeld nur als Rahmen missbraucht. Leben und Tod als Endlosspirale, verbunden durch das Vorhaben der Rache in einer Tat, sie sind das Kernzentrum dieses Abenteuers, welches seinen unfassbaren Reiz wie schon Melvilles Klassiker aus der antagonistischen Konstellation gewinnt: Ricardo Montalbáns darstellerische Leistung als genetisch modifizierter Zarathustra-Kreatur Khan kann hier nur (noch mehr als die erneuten Auftritte der klassischen Enterprise-Besatzung rund um den fantastischen Leonard Nimoy) als brillant bezeichnet werden. Seine allzu charismatische Ausstrahlung wird nur von seiner mimisch stets blitzschnell auftretenden sichtbaren Gefährlichkeit unterwandert, Khan wird zur Verkörperung des Hasses und Todes, während er das Leben kontrollieren wird. Der MacGuffin, dem er hinterher jagt, ist das Genesis-Projekt, unmissverständlich nach der biblischen Schöpfungsgeschichte benannt. Ein Projekt, welches Leben schaffen kann, dafür aber auch altes verdrängt, so wie Khan selbst ein geschaffenes Leben ist, welches andere zu verdrängen drohte. Eine glaubhafte Basis für einen Film, der sich von der metaphilosophischen Schwere des Vorgängers längst emanzipiert hat und sich traut, in rauen und harten Actiongefilden zu wandern, ohne je ausladend zu werden. Jeder Phaserschuss, jeder Schlagabtausch, jedes Manöver hat seine Geschichte, seine Motivation - und seine Konsequenzen.
Trotz des deutlich militärischeren Auftretens als je zuvor in der "Star Trek"-Historie jongliert Meyer spielerisch leicht und doch punktiert mit Lockerheit und Ernst, mit Komik und bitterer Tragik. Er formuliert den Kampf zweier Giganten als Resultat der Umstände, als schicksalshafte Ausgeburt derer Vorgeschichten, was die gesamte Erzählung mit einer bezeichnenden Emotionalität versieht, welche sich in einem Abschluss entlädt, der wie ein Fazit Leben und Tod, Alter und Jugend sowie Optimismus und Pessimismus in wenigen Sekunden ultimativ verknüpft und zusammenführt auf eine Weise, wie sie erfüllender und endgültiger nicht sein könnte - obwohl das tatsächliche Filmende alles andere als endgültig scheint, weil auch der Tod niemals vollkommen endgültig ist. Man lebt in der Erinnerung der Lebenden weiter. An "Moby Dick" erinnert dies unaufhörlich, genauso wie die neuen Uniformen der Enterprise-Besatzung oder die letzte Raumschlacht zwischen Khan und Kirk, die in einem interstellaren Nebel mit bedächtlicher Gewitteratmosphäre wie ein Gefecht auf hoher See anmutet und die Grenzen zwischen Sci-Fi-Action und Seefahrer-Literaturverfilmung subtil verwischen lässt. James Horner, der Jerry Goldsmith als Komponist hier ablöste, steuerte dazu einen Score bei, der ebenfalls beides gleichzeitig verkörpern kann und für sich stehend so viel zweipolige Kraft und Ehrlichkeit verbindet, wie die starke Geschichte selbst, die einen im selben Moment Lacher wie Tränen abverlangen kann.
Fazit: Ein Film, so authentisch und wahrhaftig wie das Leben, in einem Szenario, dass nur oberflächlich weit von unserer Realität entfernt ist und sein eigenes Setting selbst als notwendiges, im Notfall aber auch entbehrliches Konstrukt erkennt. Vor wunderschönen malerischen Weltraum-Kulissen beweist und definiert Nicholas Meyer den Begriff der Poesie auf seine ganz eigene Weise und liefert eine inszenatorische Glanzleistung ab, die von ihren lebendigen Charakteren und echten Emotionen dominiert und getragen wird und die philosophische Grundhaltung der "Star Trek"-Reihe mit den Eigenschaften des Actionfilms kombiniert, was hier keinesfalls mit einer grundsätzlich massentauglichen Ausrichtung gleichzusetzen ist, sondern als Resultat einen Meilenstein seines Genres und eine ungemeine cineastische Errungenschaft bedeutet, deren emotionalen Wert man auf gar keinen Fall missen möchte. "It was the best of times, it was the worst of times."
10/10
https://filmduelle.de/
https://letterboxd.com/casinohille/
Let the sheep out, kid.
Wennn man die einfachstmögliche Ergebnisrechnung der drei Filme des Reboots anschaut kommt folgendes raus (Budget; Einspiel; Verhältnis Einspiel/Budget):