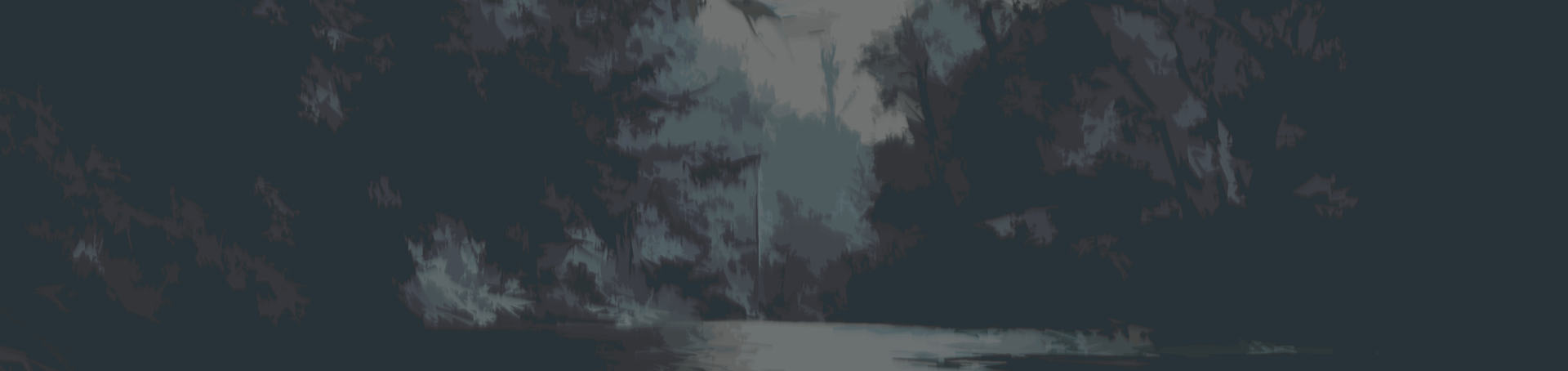285
von Casino Hille
'Q Branch' - MODERATOR
Mad Max: Jenseits der Donnerkuppel
„Zwei Mann gehen rein, ein Mann geht raus“, brüllt die Menschenmasse ekstatisch, während sie einem Käfigkampf der etwas anderen Art beiwohnen. In einer großen vergitterten halbkugelförmigen Arena stehen sich zwei Kontrahenten gegenüber. Sie sind an Gummiseilen befestigt, durch die sie den ganzen Raum der sogenannten Donnerkuppel nutzen können. Die Menge reicht den beiden Gladiatoren durch das Gitter martialische Hilfsmittel: Kettensäge, Speer und Riesenhammer.
Das Erstaunliche an dieser Actionszene ist, dass sie Mittel der filmischen Illusion ins Zentrum der Publikumsaufmerksamkeit rückt. Bei Kampfszenen, gerade bei Martial-Arts-Filmen aus dem ostasiatischen Raum, ist es Usus, die Darsteller an Drähten zu befestigen, sodass sie kontrollierte und übermenschliche Sprünge durch den Raum vollführen können oder ein Tritt in die Magengegend den Gegner mehrere Meter bis zur Wand fliegen lässt.
Normalerweise sind diese Drähte Hilfsmittel des Regisseurs, die den Zuschauern nach Möglichkeit nicht auffallen sollen. In der Donnerkuppel sind diese ‚Drähte‘ Teil des Kampfes und bedeuten somit auch, dass die beiden Krieger sie strategisch einsetzen können. Die bekannte Actionästhetik wird dadurch zum konkreten Handlungsgegenstand. Pulitzer-Preisträger Roger Ebert schrieb über diese atemberaubende Sequenz: „Die Donnerkuppel ist die erste wirklich originelle Filmidee für die Inszenierung eines Kampfes seit den ersten Karatefilmen“, und: „Die Donnerkuppel verhält sich zum Zweikampf wie 3D-Schach zu einem flachen Brett.“
George Miller musste nach seinen ersten beiden „Mad Max“-Filmen sicher nicht mehr beweisen, dass er virtuose Action kann. Der zweite Teil der Reihe, „Der Vollstrecker“, endete mit einer dreizehnminütigen Verfolgungsjagd mit dutzenden Fahrzeugen, die in die Filmgeschichte einging. Doch man tut Miller unrecht, wenn man seine dystopischen Endzeitfantasien als puristische Stunt-Show abtut. Seine große erzählerische Fähigkeit liegt darin, komplett über Bilder erzählen zu können, und sein daraus resultierendes großes Interesse, kinetisches Kino zu machen. Er arbeitet mit vertrauten Versatzstücken und Archetypen aus Western und Eastern, aus Horror- und Drama-Filmen; wichtig ist bloß: Alles muss immer in Bewegung bleiben.
An einer weiteren Rückkehr in die Welt von Mad Max hatte Miller jedoch zunächst das Interesse verloren, als 1983 sein enger Freund und Produzent Bryon Kennedy bei einem Helikopterabsturz starb. Zu dem Zeitpunkt stellte Miller gerade, in Kooperation mit anderen Regisseuren und Autoren, die australische TV-Miniserie „The Dismissal“ fertig – sie wurde Publikumshit und Kritikerliebling. Im Rückblick darauf, warum es schließlich doch zum dritten „Mad Max“ kam, erklärte er: „Ich hatte das Bedürfnis, etwas zu tun, um den Schock und die Trauer zu überwinden.“ Er erinnere sich kaum an die Entstehungsgeschichte, es sei eine Filmproduktion als Trauerbewältigungsmaßnahme gewesen.
Vermutlich deshalb halste er sich eines der bis dato teuersten Kinoprojekte in der Geschichte Australiens nicht allein auf, sondern holte sich George Ogilvie, einen seiner „The Dismissal“-Ko-Regisseure, dazu. Die Gerüchte, Miller habe die Actionszenen inszeniert und Ogilvie den Rest, wie sie nach Veröffentlichung des Films 1985 durch die Presse geisterten, treffen dabei nicht zu. Tatsächlich gab es nur wenige Tage, an denen nicht beide gemeinsam am Set waren.
Der Erfolg der Vorgänger in Übersee hatte die Reihe mittlerweile in die Popkultur befördert. Mit dem sparsamen, gar spartanischen Ursprungsfilm hat der dritte Teil nur noch wenig gemein. Ein Budget von 10 Millionen Dollar ermöglichte es dem Regie-Duo, aus den Vollen zu schöpfen. Zu hören ist das schon, wenn im Vorspann noch die Namen durchlaufen, denn niemand geringeres als Rock-Queen Tina Turner steuerte gleich zwei Songs zum Film bei („One of the Living“ & „We Don’t Need Another Hero“), mehr noch: Sie spielt als die mysteriöse Aunty die zweite Hauptfigur neben Mel Gibson.
Auch den Kulissen sieht man die erhöhten Kosten an. Nach einer kurzen Einführung landet Max in der vom Handel dominierten Kleinstadt Bartertown, einer Art post-zivilisatorischen Höllenadaption von Las Vegas, in der Tina Turners skurril-überzeichnete Aunty von einem mechatronischen Vogelnest aus den Ton angibt – zumindest scheint es so. In Wahrheit ist die Stadt horizontal geteilt. Aunty regiert als Gesetzgeberin die Oberwelt, doch ist sie abhängig von der nicht nur sprichwörtlichen Unterwelt. Dort, in einem abscheulichen Set, das Terry Gilliam zu Ehren gereicht, wird die Energiegewinnung der Siedlung geleistet – gewonnen aus Schweinekot. Tausende Schweine werden von einem bizarren Duo überwacht; einem kleinwüchsigen Tyrannen namens Master, der auf dem Rücken eines vermummten Hünen namens Blaster hockt und – nach Lust und Laune – der Oberwelt mit einem Embargo droht. Jener Blaster ist es, dem Max sich später, in Auntys Auftrag stehend, in der Donnerkuppel stellen muss.
Es sind herrlich kreative und kultige Konzepte, die Miller und Ogilvie auftischen und ihre postnukleare Welt der Warlords mit Leben füllen. Tonal fällt aber von der ersten Sekunde an auf, dass durch den dritten „Mad Max“-Film ein anderer Wind weht. Statt düster-atmosphärischer Experimentalmusik von Brian May durfte jetzt Komponist Maurice Jarre ran, der großzügig seine Arbeit für „Lawrence von Arabien“ zitiert und ansonsten auf dickes Pathos setzt. Statt harter und rasanter Fahrzeugaction zieht Max sein motorisiertes Vehikel jetzt mit Kamelen durch die Wüste – und es wird ihm direkt in der Auftaktszene gestohlen.
Die Brutalität wurde ohnehin stark zurückgefahren. Der Kampf in der Donnerkuppel verläuft unblutig und als Max seinem Kontrahenten Blaster final die Maske vom Kopf schlägt und erkennt, dass es sich um jemanden mit psychischer Behinderung handelt, weigert er sich, diesen zu töten. Dem Publikum des Kampfes gefällt diese Gnade nicht. Sie fordern weiter: „Zwei Mann gehen rein, ein Mann kommt raus.“
Das Publikum des Films tut es ihnen gleich: Unter Fans gilt dieser als der schwächste Teil der Reihe, sogar als schwarzes Schaf. Die Vorwürfe, Miller habe seine einstige Vision weichgespült, sind erst recht nicht mehr von der Hand zu weisen, als Max von Aunty in die Wüste verbannt wird und dort auf einen Klan Kinder trifft, die nach einem Flugzeugabsturz zu Überlebenskämpfern geworden sind. Tatsächlich plante Miller 1982 mal, eine eigene Version des Romanklassikers „Der Herr der Fliegen“ in Angriff zu nehmen, und nutzte einige seiner Ideen für diesen Handlungsstrang. Die Kinder erkennen in Max ihren Retter, und widerwillig wird der einstige Polizist so zur Messias-Figur für eine Rasselbande, die nicht wenige wahlweise an „Die Goonies“ oder die Lost Boys aus „Peter Pan“ erinnert.
Leider verdammt dieser Bruch der Handlung ihren Protagonisten zur passiven Figur. Max lässt sich von den Kindern in aller Ruhe erklären, wer sie sind, woher sie kommen und plant dann sogar, erstmal einfach an ihrer Seite zu bleiben. Er übernimmt erst wieder die Führung, als ein paar Kids blindlings in die Wüste davonrennen und er eine Rettungsmission starten muss. Überhaupt steht Mel Gibson in diesem Film oft im Raum und lässt sich von anderen Figuren die Handlung erklären. Selbst im großen Finale, in dem Miller und Ogilvie die famose Schlussjagd aus „Der Vollstrecker“ beinahe plagiieren, fragt Max andere Figuren, wie eigentlich der Plan lautet. „Es gibt keinen“, lautet die Antwort.
Gerade besagte Schlussaction – Max und die Kinder fliehen mit einem Zug vor Auntys Gefolgsmännern – ist eine besonders schwerwiegende Enttäuschung. Nachdem das Drehbuch eher unbeholfen den Kinder-Plot mit der Bartertown-Handlung zusammengeführt hat, wandelt sich die bisher etablierte Comic-Strip-Logik der „Mad Max“-Filme vollständig zum Cartoon-Spektakel: Kinder schlagen mit Bratwannen auf Erwachsene ein. Max kapert inmitten der Verfolgungsjagd ein schwarz-weiß geflecktes „Kuh-Mobil“. Einmal explodiert das Vehikel eines Gegenspielers, nur damit dieser danach komplett schwarz angemalt wieder im Geschehen mitmischt – ganz so, als wäre er der Koyote aus den Looney Tunes.
Tolle PS-Action sucht man vergeblich: Die gewohnt beachtliche Stunt-Arbeit wird an ein eher unbeholfenes, peinliches Slapstick-Spektakel verschwendet, in dem der sonst so coole Mel Gibson ganz schön verloren aussieht. Vor allem das Ende verärgert: Wenn die Kinder dank Max das „gelobte Land“ erreichen, dient der barocke „Mad Max“-Stil weniger noch als unterhaltsamer Selbstzweck und mehr als Mittel zur Aufblähung simpler, sentimentaler Noten. Es mag auf dem Papier eine interessante Idee gewesen sein, den mythischen, vigilanten Punk-Rächer zur Moses-Gestalt zu stilisieren, doch im Streben nach Bedeutung und einem moralisierenden Abschluss der Trilogie weicht Millers überbordender Gestaltungswille sowie sein kinetisches Talent einem klumpigen Didaktizismus.
Vielleicht war es der Trauer um Byron Kennedy geschuldet, dass das frenetische Gewaltkino einer massentauglichen Abenteuerromantik, die Düsternis der Endzeit-Wüsten einer heiter-flachen Erlöser-Metaphorik geopfert wurde. Es sollte dreißig Jahre dauern, ehe Miller seine Lust am bildgewaltigen, kinetischen Erzählen wiederfand und – allerdings ohne Gibson – zu „Mad Max“ zurückkehrte. In der Zwischenzeit drehte er seichte Familienfilme wie „Ein Schweinchen namens Babe“ und „Happy Feet“. Womöglich die richtige Entscheidung, denn „Mad Max: Jenseits der Donnerkuppel“ hat jenseits dieser Titel-Kulisse nur wenig zu bieten.
https://filmduelle.de/
https://letterboxd.com/casinohille/
Let the sheep out, kid.