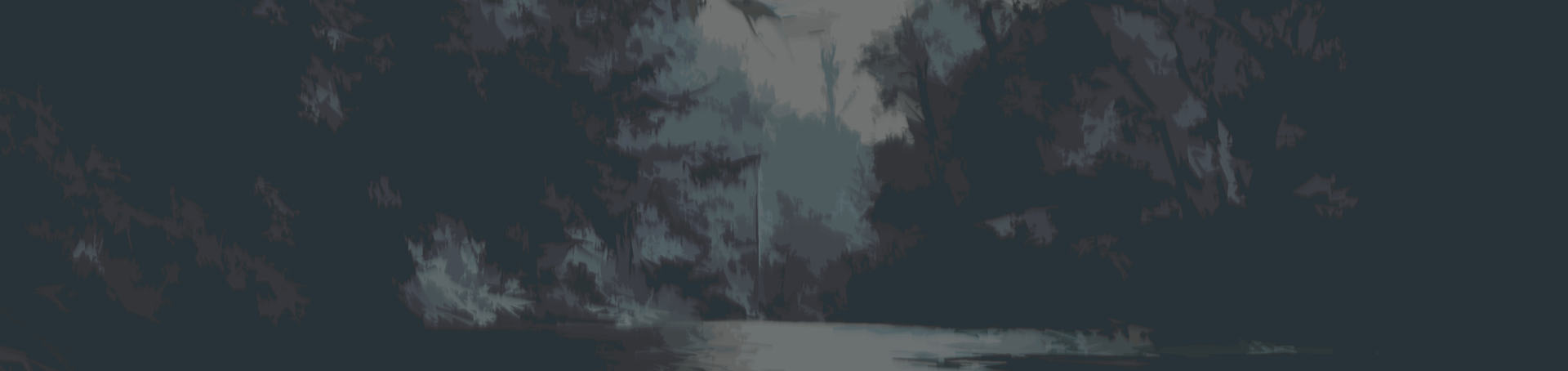3404
von AnatolGogol
Agent
12 Years a Slave (2013) – Steve McQueen
Ein mit seiner Familie in New York lebender farbiger Musiker wird Mitte des 19. Jahrhunderts nach Louisiana entführt und als Sklave verkauft. Es folgt ein zwölfjähriges Martyrium auf mehreren Plantagen, während dem er sowohl körperlich als auch seelisch schwer misshandelt wird und das ganze Elend der Sklaverei am eigenen Leib erleben muss. Soweit die Fakten zum seit einer Woche offiziell besten Film des Jahres 2013. Klingt auf den ersten Blick wie ein Paradestoff für eine weitere seichte und politisch korrekt weichgespülte Pseudogeschichtsstunde, für die Steven Spielberg ja ein ganz besonderes Händchen hat. Diese Fallstricke umgeht Regisseur Steve McQueen aber glücklicherweise weitgehend durch eine oftmals innovative und variantenreiche Inszenierung. Denn 12 Years a Slave ist einer der Filme, die weit mehr darin überzeugen wie etwas in Szene gesetzt und erzählt wird als mit dem was in Szene gesetzt und erzählt wird. So weist der Film viele begeisternde visuelle Momente auf, in denen die Leinwand oftmals förmlich leuchtet. Sowohl die in wunderbaren Bildern eingefangene Schönheit des Südens (als oftmals harter Kontrast zu den wüsten Methoden der Sklavenhaltung) als auch die oft überraschenden und einfallsreichen Kameraeinstellungen machen den Film zu einem visuellen Sahnestückchen. Ebenso peppt McQueen seine Geschichte durch immer wieder eingefügte Flashbacks in nicht unerheblichem Maße auf. Im ersten Moment wirkte dies auf mich etwas gekünstelt und bemüht - ein Eindruck der sich aber sehr schnell revidierte, da die perfekt gesetzten Flashbacks wichtige Informationen zu Geschichte und Figuren immer im dramaturgisch richtigen Moment geben, was die dramatische Wirkung der vorangegangenen bzw. folgenden Szenen deutlich erhöht. Bei einer chronologischen Erzählstruktur wäre dies in dieser Form nicht möglich. Positiv erwähnen möchte ich Hans Zimmers Soundtrack, der in seiner oft atonalen bzw. monotonalen Art sowie durch die Verwendung von Synthieklangteppichen einen merkwürdigen, aber eben auch spannenden Kontrast zu den Bildern des historischen Dramas darstellt (kurzes OT: Zimmer bleibt einfach eine Wundertüte und wechselt scheinbar mühelos zwischen ärgerlichem Popcornkleister a la Man of Steel, interessanten Arbeiten wie bei 12 Years a Slave und hervorragendem wie bei Rush.)
12 Years a Slave protzt mit einer namhaften Besetzung, wobei hier festzuhalten ist dass die meisten der bekannteren Darsteller lediglich in kurzen Nebenrollen auftreten. Dabei bieten die schauspielerischen Leistungen ein sehr weites Spektrum von nicht weiter erwähnenswert bis hin zu außergewöhnlich, was teilweise aber auch rollenbedingt ist. So geben die doch sehr klischeehaft angelegten „guten“ weissen Rollen von Cumberbatch und Pitt ihren Darstellern kaum Gelegenheit wirklich etwas zeigen zu können. Auf der anderen Seite haben es die Herrschaften Dano und Fassbender einfacher, die aufgrund der Bösartigkeit ihrer Charaktere auf der Leinwand mimisch ordentlich Dampf ablassen können und daher natürlich eher in Erinnerung bleiben. Toll ist der Miniauftritt (keine fünf Minuten) von Paul Giamatti, der wieder mal beängstigend intensiv spielt. Gut gefiel mir das Spiel der beiden farbigen Hauptakteure Chiwetel Ejiofor und Lupita Eyong´o, wenngleich gerade Ejiofor das Handicap meistern muss, dass seine oft gleichmütig agierende Figur ihm auch wenig Spielraum für echte darstellerische Großtaten zugesteht. Etwas bedauerlich ist die strikte schwarz-weiss-Malerei der Figuren, bei der es entweder die wirklich guten oder die wirklich bösen Weissen gibt und in der jeder Sklave lediglich als ausgebeutetes Individuum gezeichnet wird. Eine Figur wie die von Vanessa Redgrave in Der Butler sucht man in McQueens Sklavereidrama jedenfalls vergeblich.
Nachteilig wirkt sich zudem aus, dass Handlung und Figuren keine wirkliche Entwicklung aufweisen, eine Misshandlung folgt der nächsten, die Figuren bleiben ihren anfänglichen Grundhaltungen treu – lediglich das Level der Verzweiflung bzw. des Sadismus steigt weiter an. Hier entpuppt sich meiner Meinung nach auch McQueens doch recht distanzierte Inszenierung als etwas kontraproduktiv, da die ganzen Gräuel eher im Stile einer historischen Dokumentation in Szene gesetzt sind. McQueens Regie ist in dieser Hinsicht nicht gerade emotional, ein Mitleiden mit den Protagonisten war mir dadurch nicht wirklich möglich. Was stattdessen vermittelt wird ist Betroffenheit, ein in meinen Augen eher lauer Ersatz für Emotionalität. Ich musste vor allem bei der Auspeitschung von Patsey an Mel Gibsons Passion of the Christ denken und um wie viel intensiver und emotionaler die Wucht der Folterszenen dort in Szene gesetzt wurde (und das sicherlich nicht nur wegen des nochmals deutlich höheren Gewaltpegels).
Unterm Strich ist 12 Years a Slave dennoch ein gelungener Film, der auf künstlerischer Ebene vor allem durch seine Bilderpracht sowie durch die guten Darsteller zu überzeugen weis. Die Klischeehaftigkeit diverser Figuren, der ein oder andere erzählerische Hänger und die Tatsache, dass dem Film so etwas wie eine Moral oder eine echte Aussage abgeht (sieht man mal von der rhetorischen Weisheit ab, dass Sklaverei schlecht und verachtenswert ist) machen ihn für mich dann eben doch nur zu einem ganz guten und nicht zu einem sehr guten Film. Als vermeintlich bester Film des Jahres hätte da schon noch etwas mehr kommen dürfen.
Wertung: 7 / 10
"Ihr bescheisst ja!?" - "Wir? Äh-Äh!" - "Na Na!"